Poetikvorlesung
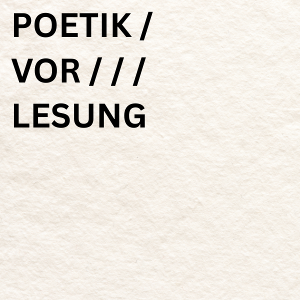
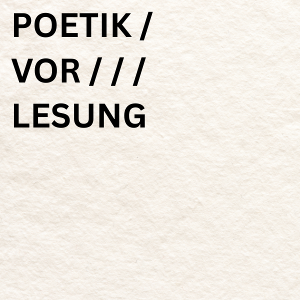
Im Mai 2024 wurde an der LMU München das Format der Poetikvorlesung reaktiviert, angesiedelt wie bei seiner Initiierung in den 1980er Jahren am Institut für Deutsche Philologie. Obwohl man an einer großen und forschungsstarken Universität ein solches Format erwarten könnte, stellt dies in München gewissermaßen eine Innovation dar: Universitäten wie beispielsweise Bamberg, Paderborn, Kassel, Mainz und natürlich Frankfurt laden teilweise seit vielen Jahren regelmäßig Autorinnen und Autoren ein, um für Studierende und andere Mitglieder der Hochschule, aber auch gegenüber einem allgemeinen Publikum über die Entstehung ihres Werkes und ihre literarischen Einflüsse zu sprechen. An der LMU ist diese Praxis zwischenzeitlich eingeschlafen. Dennoch kann die Poetikvorlesung der LMU München durchaus auf eine eindrucksvolle Tradition zurückblicken.
Die Münchner Poetikvorlesungen ließen in der Vergangenheit renommierte Autoren und Autorinnen und literarische Persönlichkeiten zu Wort kommen, welche der Einladung von Wolfgang Frühwald (1935–2019) an die LMU folgten. Im Jahr 1987 begann die Tradition der sogenannten „Münchner Poetikprofessur“. Horst Bienek sprach damals über „Das allmähliche Ersticken von Schreien. Sprache und Exil heute.“ In den folgenden Jahren setzten Persönlichkeiten wie Hugo Loetscher, Reiner Kunze, Barbara Frischmuth und Sten Nadolny ihre Akzente mit Vorträgen wie „Vom Erzählen erzählen“, „Konsequenzen des Ästhetischen“ und „Das Erzählen und die guten Absichten“. Im Wintersemester 2007/08 folgte in einer einmaligen Wiederauflage unter der Verantwortung von Oliver Jahraus der Münchner bzw. Berliner Schriftsteller Helmut Krausser.
Diese beeindruckende Tradition legt nahe, dass eine Wiederbelebung der Poetikvorlesung an der LMU München nicht nur eine Rückkehr zu einem bewährten Format darstellte, sondern auch eine Würdigung von literarischer Exzellenz und ihrer wissenschaftlichen Reflexion an einer renommierten Universität, die zudem in der Lage wäre, öffentliche Aufmerksamkeit für die Universität zu erzeugen.
Die von Kay Wolfinger im Sommersemester 2024 am Institut für Deutsche Philologie der LMU München reaktivierte Form der Poetikvorlesung stand unter dem Vorzeichen „Werkstatt und Maschinenraum“. Sie gab Einblicke in die Entstehung von Manuskripten und in die Schwierigkeiten, die beim Verbreiten von literarischen Texten und Büchern begegnen. Damit wollte die Poetikvorlesung stärker den Produktionscharakter von Texten hervorheben und mit der Einladung einer jungen, bereits mit einigen Werken hervorgetretenen Autorin eine Alternative schaffen zu arrivierten Poetikprofessuren. Hierfür konnte 2024 die Schriftstellerin Slata Roschal (www.slataroschal.de) gewonnen werden, die, 1992 geboren, mit zwei Lyrikbänden und zwei Romanen zu einer etablierten Größe der deutschsprachigen Literatur geworden ist. Roschal sprach in drei Vorlesungen über die Bedeutung des Literaturbetriebs für ihre Arbeit, über Geld, Macht und Konkurrenz, über das kollaborative Entstehen von Büchern und über die besondere Herausforderung, sich dem Literaturmarkt zu stellen, wenn man Familie und Kinder hat. Die letzte der drei Vorlesungen fand dabei in Kooperation mit der von Slata Roschal eingeladenen Autorin Katharina Bendixen (www.other-writers.de) statt.
Am 2. Juli, 9. Juli und 16. Juli 2025 wird Simon Strauß, Journalist der FAZ und Autor mehrerer produktiv diskutierter Bücher, mit seiner Vorlesungsreihe über „Neoromantik – zum Sein und Wollen des Schreibens“ einen Einblick in die Beziehung zwischen Ästhetik und Politik geben. Mit diesem sehr aktuellen und für die Studierenden und die interessierte Münchner Öffentlichkeit in seiner Brisanz interessanten Thema wird sich auch das dazugehörige Masterseminar beschäftigen, das besonders die wiederaufkommende Aktualität von engagiertem Schreiben in der Gegenwart im Anschluss an die Poetikvorlesung fokussieren wird.